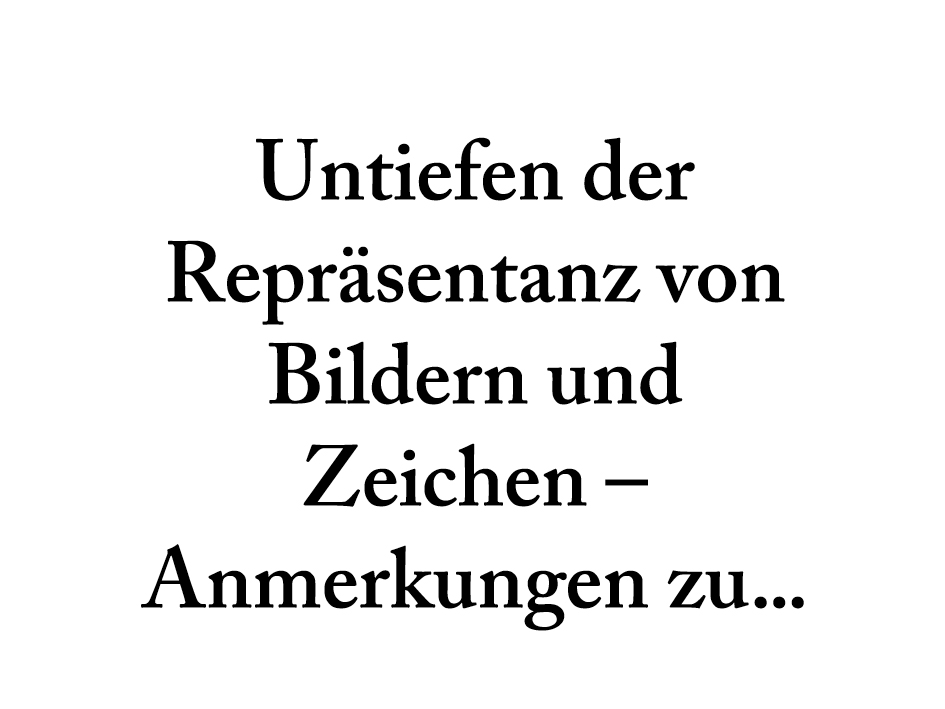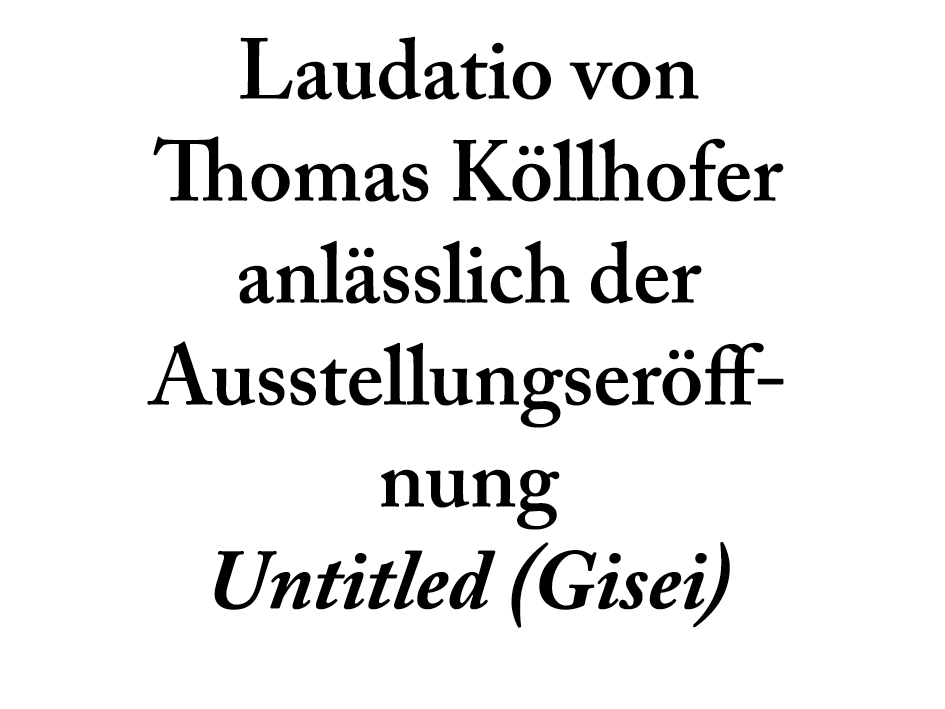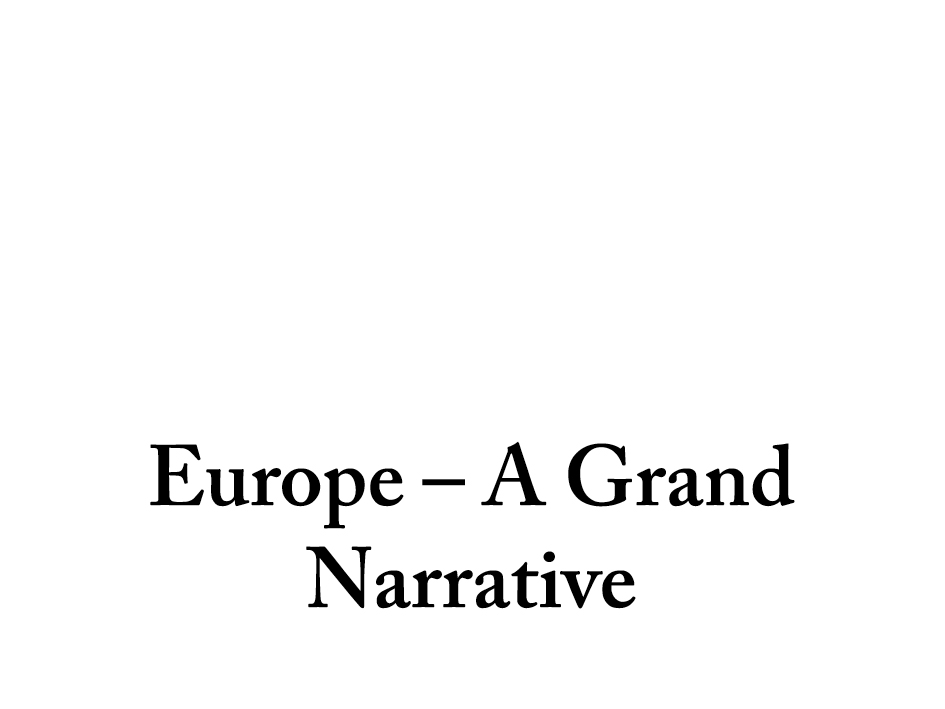Untiefen der Repräsentanz von Bildern und Zeichen –
Anmerkungen zu den Arbeiten von Özlem Günyol und Mustafa Kunt
Um sich der heterogenen künstlerischen Praxis von Özlem Günyol und Mustafa Kunt anzunähern, erscheint es hilfreich, sich weniger an formalen Modellen einer Werkproduktion zu orientieren, als viel mehr die sozialen und kulturellen Kontexte in den Blick zu nehmen, die ihre Kunst zum Gegenstand haben.
Als zentrales Thema ihrer gemeinsamen Arbeit erscheint die Auseinandersetzung mit medial vermittelten Bildern und Zeichensystemen sowie der Verknüpfung von sprachlichen und visuellen Erfahrungen. Wie diese auf die kollektive und individuelle Ausdifferenzierung von Identitäten einwirken, die durch kulturelle und soziale Rahmenbedingungen geformt und vermittelt werden, ist dabei eine ihrer Kunst inhärente Aussageebene.
Immer werden dabei auch Fragen der medialen Repräsentanz von Macht innerhalb der Subjektbildung berührt und illustrieren sich in ihrer luziden, formal äußerst heterogenen Arbeitsweise. Die machttheoretische Vernetzung der Produktion und Rezeption von Bildern in unserer Alltagskultur und der funktionalen Repräsentationsmacht des Kunstwerks in seinem spezifischen Erfahrungskontext, spielt gerade in den Arbeiten der letzten Jahre eine herausragende Rolle. Auch die Auseinandersetzung mit sprachlichen Vermittlungsformen im medialen Kontext wird immer wieder als zentrales Moment ihrer Kunst sichtbar, wobei es die innovative Praxis von Özlem Günyol und Mustafa Kunt schwierig macht, die jeweiligen Themengebiete klar voneinander zu trennen. Nicht zuletzt dadurch illustriert ihr Werk die Durchdringung und Abhängigkeit der Aspekte Medialität und Macht und der Anbindung an das kulturelle, soziale und politische Verständnis von Identität in unseren heutigen Gesellschaftsmodellen.
Neben der konzeptuellen Herangehensweise wird in Günyol und Kunts Arbeit immer wieder sichtbar, wie sich das Alleinstellungsmoment der Kunst, die ästhetische Erfahrung, deutlich als zentraler Verdichtungspunkt offenbart. So werden in den spekulativen und herausfordernden Arbeiten des Künstlerduos konzeptuelle inhaltliche Aussageebenen an ein immer auch herausforderndes ästhetisches Erlebnis gekoppelt, und verweisen damit auf die Potentiale der Gegenwartskunst -als Zeichensystem jenseits unserer medial geprägten Alltagserfahrung- Bedeutung zu generieren, ohne auf schriftliche oder rein textuelle Vermittlungsinstanzen rekurieren zu müssen. Kunst illustriert sich in ihrem Schaffen als Disziplin, die auf ein breit gefächertes sensuelles Feld verweist und damit eine gesonderte Form des Zugriffs auf unsere Umwelt ermöglicht. Ihren Arbeiten ist dabei abzuspüren, wie formal ästhetische Aspekte innerhalb der Arbeitsweise bedeutsam sind und zugleich eine kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen aufgegriffen wird.
Die Arbeit ‚… and Justice for All!’ aus dem Jahr 2010 besteht aus einem 22 Meter langen, im Durchmesser etwa fünf Zentimeter starkem Seil, das gleichmäßig ausgeleuchtet auf einem etwa 30 Zentimeter hohen Sockel akkurat zu einem lockeren Kreis zusammengelegt wurde. Auffällig erscheint die noch immer gut sichtbare, offensichtlich professionelle Bearbeitung des Ausgangsmaterials, das allerdings wenig strapazierfähig wirkt. Die Präzision, mit der das Seil gearbeitet wurde, wird durch die straffe Drillung und die exakt geknoteten und fixierten Enden auch für den Laien sichtbar. Diese augenscheinlich fachmännische Technik der Herstellung steht gegenüber dem Material, das eher an poveres Leinen oder gewebte Stoffe erinnert, in einem gewissen Spannungsverhältnis. Das Seil scheint durch die bewusste Inszenierung im Ausstellungskontext, auf einem Sockel platziert, jenseits seiner Funktion als Gebrauchsgegenstand als ästhetisches Objekt ein Eigenleben zu behaupten.
Vermeintlich wird hier ein Seil als Kunst im Sinne eines Ready mades vorgestellt, was den Transfer eines Gebrauchsgegenstands ohne Veränderungen durch den Künstler in den Erfahrungsraum der Kunst bezeichnet. Und trotzdem bleiben Zweifel, ob dieses Seil tatsächlich einem funktionalen Gebrauchszweck entfremdet wurde, zu weich wirkt das Material, das unter der Bearbeitung des Streckens und Drehens sichtbar an Grenzpunkte der Materialfähigkeit geführt wurde. Zu irritierend zeichnen sich innerhalb des gedrillten Stoffes zudem intensive grüne, gelbe, rote, orange und blaue Farbfelder ab, welche die Beige- und Ocker-Töne des restlichen Materials rhythmisieren. Auch diese unregelmäßigen Farbreflexe verweisen in ihrer intendierten Distanzierung zu einem Seil als bloßem Gebrauchsgegenstand auf grundlegende Zweifel, dass hier durch die KünstlerInnen nur ein zum Gebrauch vorgesehenes Seil als Kunstwerk in Szene gesetzt wird. Allein die genaue Betrachtung schürt in ‚… and Justice for All!’ das Misstrauen des Betrachters gegenüber dem Seil als Gegenstand des Alltags und eröffnet damit ein assoziatives Feld unterschiedlichster Möglichkeiten, wie dieses offensichtlich aus einer gezielten Intention heraus hergestellte Objekt zu verstehen sein könnte.
Eine weiterführende Auseinandersetzung mit dem Objekt verstärkt die Zweifel an der ausschließlich an der Funktionalität des Seils orientierten Existenz, da eine kurze Erläuterung darüber aufklärt, dass das Seil ursprünglich aus einem Protestbanner entstanden ist, das den titelgebenden Schriftzug ‚… and Justice for All!’ trug. Aus diesem Banner, das auf einer Demonstration Verwendung gefunden haben könnte, wurde mit den fachmännischen Mitteln der Seilerei im Freilichtmuseum dieses Objekt gefertigt, nach den traditionellen und erprobten Arbeitsschritten, die in den Werkstätten den Besuchern vorgeführt werden. Die fachlich kompetente Herstellung des Seils steht nun in einem gewissen Gegensatz zu dem verwendeten Material, da wohl mit dem leichten Nesselstoff keine professionelle Werkstatt arbeiten würde.
Özlem Günyol und Mustafa Kunt verweisen mit dem Einsatz der handwerklichen Fähigkeiten eines Dritten, des vor Ort arbeitenden Seilers, der die technische Umsetzung der Herstellung betreute, auf eine strikte konzeptuelle künstlerische Arbeitsweise, die nun die Herstellung des Werkes nicht mehr zwingend an die künstlerische Hand übertragen sieht, sondern die materielle Fertigung in andere, fachlich kompetente Hände legte. Umso deutlicher wird in dieser Arbeitsweise die Zielsetzung, jenseits der Herstellung eines Seiles eine Irritation zu inszenieren, die auf der Veränderung der Materialeigenschaften, also der Verarbeitung eines Stoffbanners zu einem Seil, beruht. Durch diesen Eingriff wird der Fokus der an dem Objekt sich entwickelnden Reflexion über die Bedeutungsinhalte der Arbeit auf eine assoziative Ebene gelenkt, die in der Bearbeitung des Materials nur ihren Anfang nimmt. Zunächst verweist die Transformation eines Banners zu einem Seil -wobei dieses eine simple und bewusst oberflächlich gehaltene Botschaft vermittelt- auf einen Prozess, der als Verfremdung des ursprünglichen Funktionszusammenhangs verläuft und diesen Zusammenhang damit entwertet. Zugleich verortete sich das Objekt nun in einem neuen Zusammenhang, dem Kunstkontext, der nun ein breit gefächertes Reflexionsfeld eröffnet, ohne dabei eine funktionale Bedeutung des Gegenstandes einzufordern. Als Kunstwerk ist das Seil einer praktischen Anwendbarkeit enthoben und kann darüber hinaus auf unterschiedlichen Ebenen wiederum als Kommentar zu gesellschaftlichen Fragestellungen gelesen werden.
Dient das Banner der Vermittlung einer politischen Botschaft oder sozialen Forderung, die im öffentlichen Raum zur Sprache gebracht wird, so erscheint das Seil nun im Kunstkontext als ein Instrument der Reflexion, das eine weitaus holistischere Denkbewegung anzustoßen in der Lage ist. Wie mir scheint, vollzieht sich die Anschlussfähigkeit der Arbeit an gesellschaftliche Fragestellungen, die den reinen Objektcharakter des Werkes hinter sich lässt, anhand einer assoziativen Lesbarkeit des Seils, das in seiner präzisen und durchaus funktionalen Präsenz vor dem Betrachter inszeniert wird.
Kann das Seil doch wieder als funktionales Zeichen des Zusammenhaltes gesellschaftlicher Gruppen verstanden werden? Ist das Seil, als ein Bild für Vernetzungen, also Kommunikation, zu verstehen, das Verbindungen, sozialen Austausch und Zugehörigkeit generieren kann? Oder wird anhand des Transformationsprozesses von einem Banner zu einem Seil die Denkbewegung einer textuellen Annäherung an soziale Fragen hin zu einer metaphorischen und damit universalen, nicht-sprachlichen Aussageebene vorgeführt?
Diese und weitere Fragen wären an die Arbeit ‚… and Justice for All!’ zu richten und verweisen immer auch auf den Kern der ästhetischen Praxis von Günyol und Kunt, den visuellen Eigenwert der Kunst, der eine assoziative Lesbarkeit ermöglicht, innerhalb einer zeitgenössischen konzeptuellen Arbeitsweise zu verankern. Sichtbar wird auch hier das Spiel mit Repräsentanzen, die auf unterschiedlichen Erfahrungsebenen ein dichtes Netz von Bedeutungen entwickeln können und das der Arbeitsweise des Künstlerpaares oftmals eingeschrieben ist.
Auf eben diese Frage der Repräsentanz, der sozialen und kulturellen Funktion und Deutungskraft des Kunstwerkes, zielt die ebenfalls im Rahmen des Stipendiums im Freilichtmuseum Hessenpark entstandene Arbeit ‚The Pedestal that has lost its Monument’ von 2010. Frei im Raum steht ein präzise gearbeiteter, weiß lackierter Sockel, der vom Boden ausgehend eine dreifache Treppung aufweist, die das untere Drittel des Sockels gliedert. Die Gesamthöhe des Objekts liegt bei etwa 1,50 Meter und beruht auf einem annähernd quadratischen Grundriss von etwa einem Meter Tiefe und Breite. Mit diesen Maßen und der Treppung im unteren Bereich erscheint das Objekt als klassizistisch geprägter, idealtypischer Sockel für eine Skulptur, die jedoch in diesem Fall, wie der Titel der Arbeit verrät, nicht präsent ist. Wir stehen nur dem Sockel gegenüber, der seine kontextuelle Verortung im Bereich der Kunst durch eine Metalltafel unterstreicht, die den Titel der Arbeit, das Entstehungsjahr und die Namen der KünstlerInnen nennt. Die Absenz eines Kunstwerks, wofür der sorgfältig gearbeitete Sockel eigentlich als Träger und Präsentationsrahmen dienen sollte, wird nun zum Werk selbst. Dieser traditionelle Kontext, den der Sockel dem Werk verleiht, wurde in der Kunst bis in das 20. Jahrhundert hinein nicht hinterfragt, jedoch war er zweifelsfrei durch seine Bindung an das Werk schon immer für jeden Betrachter sichtbar ein unmittelbares Attribut des Kunstwerks. Auf diesen Umstand aufmerksam zu machen, Kunst nicht als von kulturellen, sozialen und politischen Faktoren autonomes Modell der Vermittlung von Inhalten zu verstehen, gelingt Özlem Günyol und Mustafa Kunt in ‚The Pedestal that has lost its Monument’ auf einer ersten Aussageebene allein durch die Thematisierung dessen, was fehlt, dem Kunstwerk im traditionellen Verständnis der Kunstgeschichte.
Der Verweis auf die leer gelassene zentrale Position, die traditionell das Kunstwerk einnimmt, eröffnet für den Betrachter eine Denkbewegung, die nun die institutionellen und strategischen Kräfte der Präsenzmodelle, die jedes Kunstwerk umgeben, sichtbar machen.
Bezieht man eine kunsthistorische Betrachtung der Arbeit mit ein, so wird diese erste Ebene, welche die Arbeit trägt, durch eine weitere ergänzt. Wurde die Rolle des Sockels in der Kunst des 20. Jahrhunderts vielfach befragt und in den minimalistischen Strömungen der 1960er Jahre endgültig entwertet, so zeigt der Sockel von Günyol und Kunt eine Weiterentwicklung dieser Auseinandersetzung mit den Darstellungsmodi von Kunst. Der Titel der Arbeit geht mit dem klassischen, in seiner Gestaltung etwas altertümlich wirkenden, jedoch zweifellos neuwertigen Sockel eine Verbindung ein, die neben der physischen Präsenz des Sockels auf einer textlichen Ebene den Begriff des ‚Monumentes’ in das reflexive Spiel der Arbeit einführt. Der Sockel hat also kein Kunstwerk oder eine Skulptur ‚verloren’, wie der Titel der Arbeit berichtet, sondern sein ‚Monument’. Der Begriff ‚Monument’ konnotiert als bewusste Setzung des Künstlerpaares, wie mir scheint, eine umfassendere kulturhistorische Verdichtung, als es die anderen genannten Begriffe des Kunstwerks oder der Skulptur leisten. Das ‚Monument’ nimmt in den meisten Sprachen eine eigentümlich zeitlose, erhabene Bedeutung an. Es verweist dabei auch immer auf Traditionen und auf einen sozialen Konsens der Gesellschaften, die das Werk hervor brachte und als Kunst präsentiert. Es verweist auf eine kulturelle, politische oder soziale Leistung, auf Triumphe, kollektive Erfahrungen, auf moralische und soziale Werte und auf eine kulturelle Akzeptanz, die in ihm verdichtet und sichtbar gemacht wird. Das ‚Monument’ kann die Repräsentanz von komplexeren Prozessen leisten, als es der Begriff der Skulptur könnte.
Ich vermute in der luziden künstlerischen Arbeit von Günyol und Kunt ein Abzielen auf genau diese sprachliche Differenz, welche die Kunst an die Befragung der Bedeutung kollektiver Zeichen, Bilder und Vorstellungen bindet und darin ihre gegenwärtige Funktion formuliert. Ob und in welcher Form dies geleistet wird, welche Macht dem Kunstwerk, dem Erinnerung und Erfahrung tragenden ‚Monument’, übertragen oder auf dieses projiziert wird, dies alles wird in der unscheinbaren Verschränkung der physisch präsenten Arbeit und des Titels der Arbeit von 2010 insistierend und doch still formuliert. Das Faktum, dass der Sockel ‚sein’ ‚Monument’ verloren hat, verweist mit der ausgestellten Leerstelle auf die Bedeutung der kulturell produzierten Zeichen, deren Funktion in der Absenz des Monumentes für uns als Betrachter neu überdacht werden kann.
Beide hier vorgestellten Arbeiten, ‚… and Justice for All!’ sowie ‚The Pedestal that has lost its Monument’ wurden im Rahmen des Arbeitsaufenthaltes der beiden KünstlerInnen im Freilichtmuseum 2010 realisiert. Dieser Umstand ist nicht allein auf der Grundlage der Vergabe des Stipendiums interessant, sondern darüber hinaus durch die konzeptuelle Aufnahme der Arbeitsmöglichkeiten und der strukturellen Arbeitsweise des Museums. Zielte die Ausschreibung des Stipendiums auf eine Interaktion der aus der Stadt Frankfurt eingeladenen KünsterInnen mit den Gegebenheiten vor Ort, so wurde durch die Vergabe des Arbeitsaufenthaltes an Günyol und Kunt eine innovative Neuinterpretation der ortspezifischen künstlerischen Arbeit offensichtlich. Gegenüber einer sichtbaren Intervention in die Arbeits- und Besuchssituation entschied sich das Künstlerpaar für eine eher stille, aber umso konsequentere Einbeziehung der Arbeitsmöglichkeiten im Freilichtmuseum, das durch die unterschiedlichen Werkstätten vielfältige Möglichkeiten anbietet, die eigene kreative Tätigkeit daran anzukoppeln. Nicht die offene kritische Auseinandersetzung mit der kulturellen oder sozialen Funktion des Museums war für Günyolund Kunt von Interesse, sondern eine der Aufgaben, der sich die Institution heute stellt, nämlich der Vermittlung und Bewahrung alter, traditioneller handwerklicher Arbeitsweisen. Diese werden in den Werkstätten an die Besucher vermittelt, wurden nun aber von den beiden als zentrales Moment der Entwicklung aktueller Gegenwartskunst zum Einsatz gebracht, ohne dabei historisierende Rückgriffe zu entwickeln. Viel mehr gelang es ihnen, die traditionellen Techniken in einen fruchtbaren Dialog mit einer aktuellen, konzeptuellen künstlerischen Praxis zu stellen, um damit eine innovative Form der Weiterentwicklung dieser Handwerkstechniken zu erreichen. Der zurückgenommene Zugriff auf situative Gegebenheiten des Freilichtmuseums konnte dabei eine umso nachhaltigere Entfaltung innerhalb der Werke erleben und schließt die vor Ort vorgestellten Handwerksarbeiten an einen innovativen zeitgenössischen Produktionsdiskurs der jungen Gegenwartskunst an.
Wie in den Werkinterpretationen und der kurzen Diskussion der Arbeit von Günyol und Kunt sichtbar wurde, setzten sie sich im Kontext ihrer kritischen künstlerischen Bezugnahme offensichtlich mit einer unmittelbar erlebten Differenz unterschiedlicher Modelle des individuellen und kollektiven Identitätsverständnisses und dessen medialer Vermittlung auseinander. Durch ihre Sozialisation in der Türkei und der anschließenden Integration in Deutschland konnten sie aus eigener Erfahrung erleben, wie verschieden Vorstellungen von Identität auf sozialer und politischer Ebene entwickelt werden und wie diese durch mediale Vermittlungsinstanzen heute mehr denn je als Spannungsfeld zwischen subjektiven und machttheoretischen Aspekten erlebbar wird.
Welche zumeist medial vermittelten Konstruktionsmechanismen dabei über kulturell und historisch geprägte Disziplinierungsinstanzen in unterschiedlichen Kulturen und Wertesystemen auf das Individuum einwirken, wurde somit zu einem Ausgangspunkt ihrer luziden künstlerischen Tätigkeit, die generelle, gesamtgesellschaftliche Aussagen über unsere Gegenwart zu artikulieren versteht.